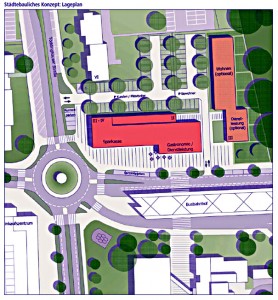Windräder auf der Halde? Diskussion geht weiter
Bekommt Bergkamen neue Windräder? Und wo werden sie aufgestellt? Tatsächlich auf der Halde – oder zumindest am Fuß der Halde? Oder ganz woanders? Die SPD-Fraktion ist sich nicht einig.

„Die Meinungen bei uns sind sehr konträr“, sagt SPD-Fraktionschef Gerd Kampmeyer. Doch die SPD-Fraktion einigte sich jetzt auf einen Kompromiss. Und der folgt einem Gutachten und heißt Chemie-Gelände (ehemals Schering). Die Halde dagegen bleibt tabu. Zumindest zurzeit.
Ein von der Stadt Bergkamen beauftragter Gutachter meint, dass als Windkonzentrationsfläche die Randbereiche des Chemieparks optimal seien. Das Problem: Das Gelände ist Privateigentum. Ohne die Genehmigung des Bayer-Konzerns kann dort niemand ein Windrad oder gar einen ganzen Windpark (mindestens drei Windräder) errichten.
Immerhin: Gespräche mit der Bayer AG wurden von der Stadtverwaltung mittlerweile aufgenommen.
Für Kampmeyer ist das große Interesse an solchen Windrädern nachvollziehbar. „So ein Windrad soll in 20 Jahren rund 3 Mio. Euro an Ertrag abwerfen.“
Auch die heimischen Stadtwerke GSW sind deshalb interessiert. Für Kampmeyer wäre ein GSW-Windrad in Bergkamen ein gutes Modell – eine Art moderner Bürgerbeteiligung. „Vom Gewinn würden alle GSW-Kunden auf ihrer Strom- oder Gasrechnung profitieren.“
Und wenn die Bayer AG ablehnt?
Erst wenn der Chemieriese die Idee ablehnt, will die SPD-Fraktion sich mit weiteren möglichen Stellflächen für Windräder beschäftigen.
Allerdings sind darunter keine großen Flächen mehr für ganze Windparks. „Wir reden dann von Einzelfallentscheidungen“, sagt Kampmeyer, also von allein stehenden Windrädern. Etwa am Sesekeknie (Stadtgrenze Lünen) oder tatsächlich am Fuß der Halde.
Diese beiden Flächen sind aber – wie Bayer – in Privatbesitz. Und gerade bei der attraktiven Halde, dem beliebten Freizeitgebiet, wehren sich einige Genossen mit Händen und Füßen, während sich andere an dieser Stelle durchaus ein künstlerisch blau angestrahltes Windrad vorstellen könnten.