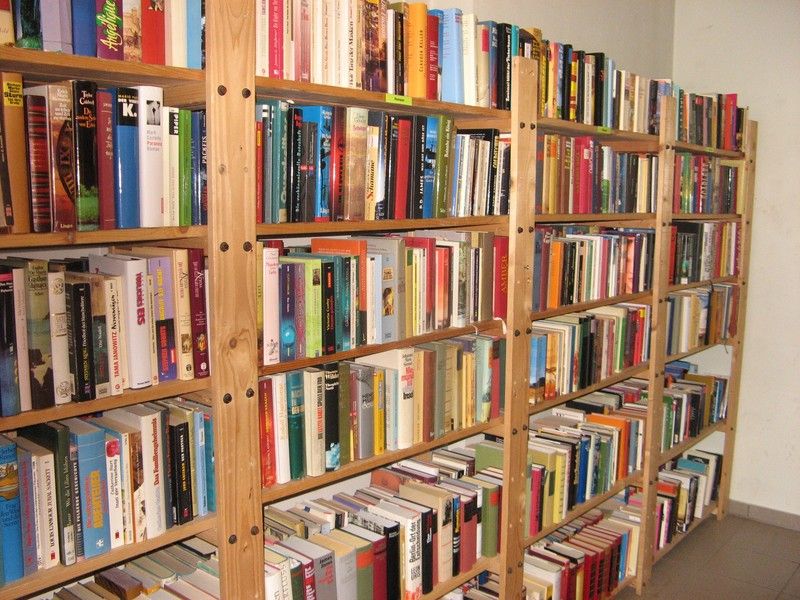Faltblatt soll helfen, Zahl der verwilderten Katzen einzudämmen
Die Zahl der in Bergkamen freilebenden und zum Großteil verwilderten Katzen ist nach den Beobachtungen des Ordnungsamts und von Tierschutzvereinen seit Jahren gestiegen. Darin sehen sie ein großes Problem. Helfen soll hier ein Faltblatt mit infos zum Thema, das jetzt haushaltsdeckend vereitlt wird.
 Sowohl die politischen Gremien als auch die Verwaltung der Stadt Bergkamen haben sich schon vor längerer Zeit des Themas angenommen und zuletzt im Rat der Stadt Bergkamen die Frage von Katzenregistrierung und Kastrationspflicht diskutiert. Da allerdings als Ergebnis festgestellt wurde, dass man über Verordnungen oder andere gesetzliche Bestimmungen die Probleme nicht lösen könne, wurde die Verwaltung beauftragt, einen Flyer zu erstellen, der auf die verschiedenen Probleme hinweist und vor allem darüber aufklärt, wie jeder Bürger mithelfen kann, die mit den wild lebenden Katzen einhergehenden Probleme zu verringern bzw. zu lösen.
Sowohl die politischen Gremien als auch die Verwaltung der Stadt Bergkamen haben sich schon vor längerer Zeit des Themas angenommen und zuletzt im Rat der Stadt Bergkamen die Frage von Katzenregistrierung und Kastrationspflicht diskutiert. Da allerdings als Ergebnis festgestellt wurde, dass man über Verordnungen oder andere gesetzliche Bestimmungen die Probleme nicht lösen könne, wurde die Verwaltung beauftragt, einen Flyer zu erstellen, der auf die verschiedenen Probleme hinweist und vor allem darüber aufklärt, wie jeder Bürger mithelfen kann, die mit den wild lebenden Katzen einhergehenden Probleme zu verringern bzw. zu lösen.
„Denn nicht alle Katzen können eingefangen und dem Kreistierheim zugeführt werden, dazu reichen die Kapazitäten bei Weitem nicht aus“, so Heiko Brüggenthies vom Ordnungsamt. Ursache für die ständig ansteigende Katzenpopulation sei die hohe Zahl an verwilderten Katzen und freilaufenden Hauskatzen, die nicht kastriert seien und sich somit ungehindert fortpflanzen könnten.
Da vermehrungsfähige Katzen zweimal im Jahr 4 bis 6 Junge bekommen könnten und diese wiederum nach 6 Monaten geschlechtsreif seien, steige die Zehl der Katzen stark an, wenn die Rahmenbedingungen für eine solche Entwicklung stimmen. „Das heißt: Durch das Füttern von freilebenden Katzen hilft man dem Problem nicht ab, sondern unterstützt noch den Vermehrungsprozess“, erklärt Brüggenthies.
Der vom Bürgerbüro der Stadt Bergkamen erstellte Flyer soll Wege aufzeigen, die helfen, ein unkontrolliertes Ansteigen der Katzenzahl zu verhindern. Dazu gehört sowohl der Hinweis auf Eigenverantwortung von Katzenhaltern hinsichtlich der Kastration von Katern und Katzen aber auch der Hinweis darauf, seine eigene Katze nur innerhalb von Räumlichkeiten und nicht im Garten oder auf der Terrasse zu füttern, um das „Fremdfüttern“ von Freigängern und fremden Katzen zu unterbinden und vor allem das Einrichten von Futterstellen zu unterlassen.