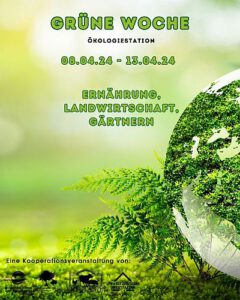Lippeverband bietet Schülerinnen und Schülern spannenden Unterricht am Gewässer an

Unterricht in der Natur direkt an der Lippe und ihren Nebenläufen: Das ist ab sofort wieder möglich. Bis zum 11. Oktober bietet der Lippeverband spannende Exkursionen für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 8. Klasse innerhalb des BNE-(Bildung für nachhaltige Entwicklung)-Programms „Auf ins Neue Emschertal“ an. In Hamm, Kamen, Lünen, Dinslaken, Voerde und Wesel können die Bachlandschaften während der zwei- bis dreistündigen Unterrichtsbausteine genauestens unter die Lupe genommen werden. Dabei erhalten die Kinder und Jugendlichen nicht nur spannende Infos rund um die Gewässer, sondern werden bei Untersuchungen von Pflanzen und Tieren am Fluss auch selbst forschend aktiv. Termine können mit den Exkursionsleiter*innen individuell vereinbart werden. Die Teilnahme ist kostenlos.
Im Mittelpunkt der Exkursionen steht das Erforschen der Lippe und ihrer Zuflüsse als Lebensräume. Und da gibt es mittlerweile einiges zu entdecken: Nachdem das ursprüngliche Flusssystem der Lippe mit seinen einst lebendigen Auen während der Industrialisierung künstlich ausgebaut wurde, engagiert sich der Lippeverband bereits seit den 80er-Jahren dafür, die Flüsse und Bäche wieder in ihren naturnahen Zustand zurückzuführen. Ein Großteil der bereits umgebauten Gewässerlandschaften wurde schon von der Tier- und Pflanzenwelt zurückerobert. Neue Naturbiotope und Freizeitareale sind entstanden. Diesen Naturraum können Kinder und Jugendliche bei eigenen Gewässeruntersuchungen erleben – Pflanzen und Kleintiere werden gesammelt und bestimmt sowie eine eigene Gewässeruntersuchung vor Ort durchgeführt.
In Kooperation mit der Didaktik der Biologie der Universität Duisburg-Essen entwickelt, fördert das BNE-Angebot verschiedene Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Ganz nebenbei erlernen sie beispielsweise, wie man Erkenntnisse gewinnt und bewertet – der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.
Sechs Bildungsstandorte
Wählen können die Schulen zwischen sechs Bildungsstandorten: Enniger Bach, Geinegge und Geithe in Hamm, Heerener Mühlbach/Mündung Seseke in Kamen, der Rühenbecke in Lünen, dem Rotbach in Dinslaken, der Rotbach-Mündung in Voerde und der Lippe in Wesel.
Individuelle Terminabsprache
Individuelle Termine können mit der jeweiligen Exkursionsleitung vereinbart werden: In Hamm am Enniger Bach, an der Geinegge und der Geithe bringt Birgit Stöwer den Schulklassen die Natur an den Gewässern näher (Telefon 02382 783487, birgit.stoewer@erlebnis-natur.de). Ansprechpartnerin für den Heerener Mühlbach und die Mündung Seseke ist Gisela Niermann (02303 60070 oder 0163 2937227, niermannle@gmx.de). An der Rühenbecke in Lünen und der Lippe in Wesel engagiert sich Christiane Hüdepohl (02306 740511 oder 0157 36736961, chuedepohl@t-online.de). Für die Exkursion am Rotbach in Dinslaken sowie an der Rotbach-Mündung in Voerde kann Petra Sperlbaum (02855 850582 oder 0172 9553167, ps@wasserfrosch-naturerlebnis.de) kontaktiert werden.
Der Lippeverband
Der Lippeverband ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Seine Aufgaben sind in erster Linie die Abwasserentsorgung und -reinigung, Hochwasserschutz durch Deiche und Pumpwerke und die Gewässerunterhaltung und -entwicklung. Dazu gehört auch die ökologische Verbesserung technisch ausgebauter Nebenläufe. Darüber hinaus kümmert sich der Lippeverband in enger Abstimmung mit dem Land NRW um die Renaturierung der Lippe. Dem Lippeverband gehören zurzeit 155 Kommunen und Unternehmen als Mitglieder an, die mit ihren Beiträgen die Verbandsaufgaben finanzieren. www.eglv.de