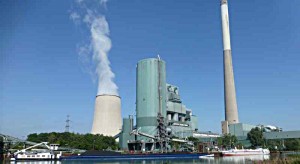Neue Selbsthilfegruppe Depressionen – Treffen in Lünen geplant
Die Depression ist eine ernste psychische Erkrankung und die am häufigsten auftreten-de psychische Störung. In Lünen ist die Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe für Betroffene in Planung. Informationen gibt es bei der K.I.S.S.
Eine Depression ist mehr als ein „schlechter Tag“, den alle Menschen erleben. Gefühle der Antriebslosigkeit, innere Leere, Zukunftsängste, Grübel-Neigung und auch Trauer dominieren bei einer Depression über mehrere Wochen. Auch körperliche Symptome können auftreten, beispielsweise Schlafstörungen oder Appetitmangel.
Negative Denkmuster und eine pessimistische Einstellung gegenüber sich selbst und der Welt schlechthin beherrschen das Denken. Das komplette Leben verändert sich. Viele Betroffene isolieren sich und nehmen nicht mehr am sozialen Leben teil.
Neben der Behandlung der Depression mit Medikamenten und/oder einer Psychotherapie kann ein Gesprächskreis mit Betroffenen eine hilfreiche Ergänzung sein. Insbesondere nach einem stationären oder ambulanten Klinikaufenthalt ist das Gespräch mit anderen Betroffenen oft sehr hilfreich. Dabei kann die Gruppe ein Schritt aus der Einsamkeit sein und bietet die Möglichkeit, über die Erkrankung zu sprechen und gemeinsam nach vorn zu schauen.
Im Mittelpunkt der neuen Selbsthilfegruppe in Lünen steht der Austausch über Erfahrungen, aber vor allem auch das gegenseitig Zuhören. Dabei ist wichtig zu wissen, dass Selbsthilfegruppen ohne professionelle Leitung (ohne Therapeut oder Arzt) sind und von den Betroffenen selbst organisiert werden.
Interessierte Betroffene sind herzlich eingeladen, in diesem neuen Gesprächskreis mitzumachen und ihn aktiv mitzugestalten. Weitere Informationen gibt es bei der K.I.S.S. – Kontakt- und InformationsStelle für Selbsthilfegruppen im Treffpunkt Gesundheit in Schwerte, Kleppingstraße 4. Die Ansprechpartnerin Thekla Pante ist unter Tel. 0 23 04 / 2 40 70-22 oder per E-Mail an thekla.pante@kreis-unna.de erreichbar. Alle Anfragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.